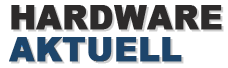IBM
OS/2
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| OS/2 Warp | |
| Bildschirmfoto | |
 |
|
| Basisdaten | |
| Entwickler | IBM / Microsoft |
| Version | Warp 4.52 (Januar 2002) |
| Abstammung | Multitasking MS-DOS OS/2 |
| Architekturen | x86 |
| Lizenz | Proprietär |
| Sonstiges | Preis: kostenpflichtig Entwicklung: 2005 beendet; wird mit eComStation aber weitergeführt |
| Website | www.ibm.com/os2/ |
OS/2 (Operating System/2 – anfangs bei IBM Deutschland auch BS/2 für Betriebssystem/2) ist ein Multitasking-fähiges Betriebssystem für den PC. Es wurde ursprünglich als Nachfolger für DOS von IBM und Microsoft gemeinsam entwickelt. Nachdem Microsoft 1991 die Kooperation beendete (um sich stattdessen der Windows-Weiterentwicklung zu widmen), entwickelte IBM OS/2 allein weiter. 2005 wurden der Vertrieb und die Basisentwicklung von IBM eingestellt, unter der Markenbezeichnung eComStation ist das Betriebssystem in einer angepassten Version weiterhin erhältlich.
OS/2 konnte neben speziell für OS/2 entwickelten Programmen auch in mehreren virtuellen Maschinen MS-DOS-Programme und mittels WinOS/2 Windows-3.1-Programme ausführen. Mit Win32s und vor allem dem Projekt Odin[1] ist es möglich, einige Win32-Programme innerhalb der OS/2 Umgebung zu nutzen. Über Virtual PC, das vor der Übernahme von Connectix durch Microsoft auch für OS/2 verfügbar war, oder Bochs lassen sich auch komplette Win32-Umgebungen starten.
Für die einfache Überführung von Windows in OS/2-Anwendungen existiert die Schnittstelle Open32. Zudem gibt es Bibliotheken und Entwicklungswerkzeuge, welche die Portierung von Unix-Anwendungen unterstützen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Geschichte
Im Heim-Bereich war OS/2 wegen seiner Stabilität und des schon auf Rechnern mit i386-Prozessor effizienten Multitaskings als Basis für Mailboxen sehr beliebt. Die Version OS/2 Warp 3 war Mitte der 1990er Jahre auf den Rechnern einiger Computerketten (u.a. Vobis, Escom) vorinstalliert. Dies war allerdings eine größtenteils auf Deutschland beschränkte Erscheinung. Dort konnte OS/2 Mitte der 1990er Jahre einen gewissen Marktanteil gewinnen. Weltweit konnte sich OS/2 jedoch nie gegen Windows durchsetzen, unter anderem weil es höhere Anforderungen an die Hardware stellte. Insbesondere waren acht, besser zwölf Megabyte Arbeitsspeicher notwendig, um die Leistungsfähigkeit wirklich nutzen zu können. Dies war zu dieser Zeit noch recht teuer. Viele Vorinstallationen hatten meist den Fehler, dass die Rechner nur vier MB Arbeitsspeicher hatten und deshalb sehr langsam waren, da das System permanent mit Auslagern auf die Festplatte beschäftigt war.
Durch das schlechte und widersprüchliche Marketing von IBM war ein Scheitern am Markt vorbestimmt; IBM bewarb OS/2 auf der einen Seite als Lösung für jugendliche Computerfreaks, hatte aber andererseits einen Großteil Firmenkunden, die ganz andere Anforderungen stellten. Spiele gab es vergleichsweise wenige, brauchbare Büroanwendungen nur von wenig bekannten Herstellern. Die bekannten Büroanwendungen des Marktführers Microsoft gab es zwar, diese waren jedoch 16-bittig, deutlich langsamer und instabiler als ihre Windows-Pendants. Ein weiterer Grund für das Scheitern von OS/2 im Massenmarkt wurde vermutlich auch das Verhalten Microsofts, wie es unter anderem im Kartellverfahren in den USA aufgedeckt wurde. Diese Vorgänge sind in den freigegebenen Gerichtsprotokollen dokumentiert.
OS/2 sollte ferner für den PowerPC-Prozessor weiterentwickelt werden. Dabei war auch eine Version im Gespräch, die auf Macintosh-Rechnern (Mac) von Apple laufen sollte. Ein Variante sollte das betagte Mac OS ablösen, das nicht zu präemptivem Multitasking fähig war. Apple ist aber sehr schnell aus dieser Entwicklung ausgestiegen, so dass eine breitere Basis für das Betriebssystem nicht vorhanden war. In der Computerwoche hieß es z. B.: „Laut Infoworld soll ein Wechsel zwischen Mac OS und OS/2 für Power-PCs möglich sein. Dabei werde der Kern des Apple-Betriebssystems ausgetauscht und jener Speicherbaustein abgeschaltet, der in allen Macs Teile des Betriebssystems enthält.“[2] Dieses wurde dann präzisiert: „Auf Power-PCs laufen zur Zeit die Betriebssysteme Mac-OS 7.1.2 und Windows NT, demnächst wohl auch IBMs OS/2.“[3] Dass es offiziell nicht so weit kam, war ein weiterer Grund für den Tod von OS/2.
OS/2 hatte von Anfang an Eigenschaften, die erst später in anderen PC-Betriebssystemen umgesetzt wurden. Ein Beispiel ist Speicherschutz, welcher verhindert, dass eine fehlerhafte Anwendung ein anderes Programm oder das gesamte System in Mitleidenschaft zieht. Dazu kommt präemptives Multitasking. Ein weiteres Beispiel ist die Möglichkeit, für verschiedene Programme (aus Kompatibilitätsgründen) mehrere Versionen einer Programmbibliothek gleichzeitig halten zu können. Diese Möglichkeit bot Microsoft erst mit Windows NT 3.1.
[Bearbeiten] Verwendung des Betriebssystems heute
Mittlerweile wird OS/2 im Heim-Bereich wegen des geringeren Angebots aktueller Software kaum noch eingesetzt und auch bei Banken, Versicherungen und Fluggesellschaften ist es rückläufig. Neue Installationen werden meistens mit der eComStation-Distribution realisiert. Daneben findet es noch im Bereich der Haustechnik und der Sicherheitstechnik Verwendung. Außerdem füllt es eine gewisse Nische in der Fertigungsindustrie aus.
Ein besonders in dieser Zeit immer wichtigerer Aspekt zur Nutzung von eComStation (eCS) ist die hohe Sicherheit gegen Viren, Trojaner und Würmer. Es sind bisher keine erfolgreichen Angriffe aus dem Netz auf OS/2- oder eCS-Systeme bekannt geworden.
[Bearbeiten] Aktuelle Situation
IBM hat im Winter 2002 das Ende des Privatkundenvertriebs von OS/2 angekündigt. Geschäftskunden werden weiterhin von IBM mit OS/2 beliefert. Der Kundendienst von IBM endete am 31. Dezember 2006.[4] IBM rät seinen Kunden zu einem Umstieg auf Linux.
Der Vertrieb wurde schon 2001 von der Firma Serenity Systems, als Lizenzprodukt, unter der Bezeichnung eComStation übernommen. Allerdings hat man dort keinen Zugriff auf die Quelltexte, so dass Weiterentwicklungen des Betriebssystemkerns nicht zu erwarten sind. Dafür wurde die Arbeitsoberfläche weiterentwickelt, die Installation vereinfacht, Teile des Betriebssystems erneuert und mit Hilfe einer engagierten Anwendergemeinschaft die Software-Basis für eComStation und OS/2 beträchtlich erweitert.
Es gibt auch Bestrebungen, ein zu OS/2 kompatibles Open-Source-Betriebssystem zu entwickeln. Das Projekt nennt sich osFree und befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium.
[Bearbeiten] Präsentations-Manager
Die mit Version 1.1 eingeführte grafische Benutzeroberfläche wird als Präsentations-Manager (engl. Presentation Manager, PM) bezeichnet und entspricht den IBM-Richtlinien SAA und CUA. Ab Version 2.0 wurde die Arbeitsoberfläche (engl. Workplace Shell, WPS) als objektorientierte Benutzerschnittstelle verwendet, welche auf der Objekttechnologie SOM basiert. Kein modernes Betriebssystem-Äquivalent hat etwas Vergleichbares, welche die Benutzeroberfläche des Betriebssystems als vollständig objektorientierten Schreibtisch darstellt. Das Design der WPS hatte ein Problem: Es gab für die Benutzereingabe nur eine Message-Queue. Blockiert eine fehlerhafte Anwendung diese, gibt es keine Möglichkeit mehr mit dem Betriebssystem zu kommunizieren.
Ein Projekt, die WPS auf einen neuen Betriebssystemunterbau zu bringen, heißt Voyager.[5]
[Bearbeiten] Dateisysteme
[Bearbeiten] FAT
Die erste Version unterstützte nur DOS-Partitionen bis zu einer Größe von 32 MB. Mit Version 1.1 kam die erweiterte FAT-Unterstützung ähnlich DOS 4.0 für Partitionsgrößen bis 2 GB hinzu. Die langen Dateinamen und erweiterten Attribute werden in zwei gesonderten Dateien verwaltet.
[Bearbeiten] Installierbare Dateisysteme
Eine besondere Eigenschaft des OS/2 ist die Möglichkeit, über beim Systemstart geladene Treiber den Zugriff auf im Prinzip beliebige andere Dateisysteme zu ermöglichen. So existieren zum Beispiel Treiber für die Dateisysteme FAT32 oder ext2. Daneben gab es Besonderheiten wie Zipstream, wo alle Dateien komprimiert, oder Cryptstream, wo sie verschlüsselt abgespeichert wurden und über ein beliebig definierbares virtuelles Laufwerk angesprochen werden konnten.
[Bearbeiten] HPFS
HPFS (für High Performance File System) ist das Dateisystem von OS/2. Die ursprüngliche 16-Bit-Version, in der Programmiersprache C geschrieben, ist von Microsoft geschaffen worden. HPFS unterstützt lange Dateinamen mit bis zu 255 Zeichen sowie sogenannte erweiterte Attribute, die es erlauben, beliebige Metainformationen mit einer Größe von bis zu 64 kB an eine Datei zu binden, ohne dass deren Nutzdaten verändert werden. So lässt sich z. B. eindeutig hinterlegen, mit welcher Anwendung eine Datei bearbeitet werden kann. Hierdurch entfällt gleichzeitig der Zwang, einer Datei eine bestimmte Dateiendung geben zu müssen (wie z. B. unter Windows). Auf Festplatten haben IFS-Partitionen die Partitionssignatur (7).
[Bearbeiten] HPFS 386
Für den IBM LAN Server hat IBM selbst eine vollständig in Assembler implementierte 32-Bit-Version dieses Dateisystems entwickelt, HPFS386 oder auch IBM386FS. Diese war extrem schnell und bot erweiterte Sicherheitsfunktionen. Sie war auch mit Standard-OS/2 lauffähig, wurde aber den offiziell vertriebenen OS/2-Versionen nie beigegeben. Einige für Standard-HPFS programmierte Hilfsprogramme, etwa solche zur Wiederherstellung gelöschter Dateien, waren allerdings unter der 32-Bit-Variante nicht mehr funktionsfähig.
[Bearbeiten] JFS
Seit 1999 unterstützt OS/2 (WarpServer for e-business) auch das Journaled File System (JFS). Dadurch sind auch Partitionen, welche in der LVM-Terminologie Volumen genannt werden, von über 64 GB und Dateien über 2 GB möglich.
[Bearbeiten] CDFS
Das CD-ROM-Dateisystem stellt die Unterstützung für CD-ROM-Einheiten bereit und kann ab OS/2 Version 2.0 eingesetzt werden. Spätere Versionen dieses IFS-Treibers ermöglichen auch den Zugriff auf Medien in Microsofts Joliet-Format.
[Bearbeiten] UDF
Für wiederbeschreibbare Wechselmedien (CD-RW, DVD-RAM) kann das UDF verwendet werden.
[Bearbeiten] TVFS
Das Toronto Virtual File System ist ein virtuelles Dateisystem, d.h. es wird nicht zur Formatierung von Datenträgern verwendet; stattdessen vermittelt es Dateisystemzugriffe, indem z. B. ein bestimmtes Verzeichnis unter einem Laufwerksbuchstaben als virtuelles Laufwerk zur Verfügung gestellt wird. Im Unterschied zum DOS-Befehl SUBST ist es aber z. B. möglich, dabei den Zugriff auf Leseoperationen zu beschränken oder aber ein virtuelles Laufwerk mit mehreren Verzeichnissen zu verbinden, von denen nur eines schreibbar ist[6]. TVFS wurde bei IBM in Toronto entwickelt, läuft ab OS/2 v2[7] und steht zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung.
[Bearbeiten] Versionsgeschichte
[Bearbeiten] 16-Bit-Versionen
- Microsoft (OEM)
- Microsoft OS/2 1.0 – 1987
- Microsoft OS/2 1.1 – 1988 mit Presentation Manager
- Microsoft OS/2 1.2 – 1989 Unterstützung für HPFS
- Microsoft OS/2 1.3 – 1991 Grundlage für den MS LAN Manager 2.1, bereits mit HPFS386.
- IBM
- IBM BS/2 1.0 Standardversion – Dezember 1987, Textmodus
- IBM BS/2 1.0 Erweiterte Version – Juli 1988, Kommunikationsmanager und Datenbankmanager
- IBM OS/2 1.1 Standardversion – Oktober 1988, erstmals mit Präsentations-Manager
- IBM OS/2 1.1 Extended Edition – Anfang 1989
- IBM OS/2 1.2 Standardversion – November 1989
- IBM OS/2 1.2 Erweiterte Version – Januar 1990
- IBM OS/2 1.3 Standardversion – November 1990
- IBM OS/2 1.3 Erweiterte Version – Februar 1991
[Bearbeiten] 32-Bit-Versionen
- IBM
- IBM OS/2 2.0 Limited Edition - 1991 Vorabversion
- IBM OS/2 2.0 – 31. März 1992, 32 Bit, i386-basiert.
- IBM OS/2 2.1 – Mai 1993
- IBM OS/2 2.1 für Windows – Dezember 1993, ein OS/2 2.1, 3.0 Warp ohne Windows-3.1-Emulation. Die Original-Windows-3.1/3.11-Installation wurde dabei integriert. Selbiges gilt auch für OS/2 Warp 3.0 für Windows.
- IBM OS/2 2.11 – Februar 1994
- IBM OS/2 Warp 3.0 – September 1994
- IBM OS/2 Warp 3.0 für Windows – Oktober 1994
- IBM OS/2 2.11 SMP – Dezember 1994, Unterstützt SMP bis 16 Prozessoren
- IBM OS/2 Warp Connect 3.0 – 1995
- IBM OS/2 Warp Server 4.0 Aurora – 1996, Grundsystem war OS/2 Warp 3.0 Connect mit den neuesten Bugfixes und der neuesten Version des TCP/IP-Stacks. Es gab eine Standard- und eine Advanced-Version. Letztere enthielt mehr Netzwerkzeuge und das Dateisystem HPFS386.
- IBM OS/2 Warp 4 Merlin – September 1996, OpenGL-Unterstützung
- IBM WorkSpace on-Demand 1.0 – 1997
- IBM WorkSpace on-Demand 2.0 – 1999
- IBM OS/2 Warp Server for e-Business (4.50) – 1999
- IBM OS/2 Warp 4.51 Convenience Package 1 – Dezember 2000
- IBM OS/2 Warp 4.52 Convenience Package 2 – Januar 2002
- in Lizenz von Serenity Systems
- eComStation 1.0 – 2001
- eComStation 1.1 – 2003
- eComStation 1.2 – 2004 (Überarbeitung: eComStation 1.2R – 2006)
[Bearbeiten] Trivia
OS/2 Warp 4 hatte einen Product-placement-Auftritt in dem James-Bond-Film GoldenEye, wo es auf den Rechnern des Observatoriums lief.
[Bearbeiten] Literatur
- Bernd Rohrbach, OS/2 Warp V4 in Team C&L Verlag, 1996, ISBN 3-932311-02-7
[Bearbeiten] Einzelnachweise
- ↑ Projekt Odin
- ↑ Computerwoche 1/1995
- ↑ Computerwoche 42/1995
- ↑ Meldung auf heise.de
- ↑ Voyager
- ↑ [1]
- ↑ [2]
[Bearbeiten] Weblinks
- IBM OS/2 Product Overview (englisch)
- netlabs.org, Open-Source-Software Entwicklung für OS/2 und eCS (englisch)
- osFree, Open-Source-Variante von OS/2 (englisch)
- Warpstock, jährliche eCS- / OS/2-Konferenz (englisch)
- V.O.I.C.E., eine Organisation zur Förderung von OS/2
- eCSoft/2, The eComStation and OS/2 Software Guide (englisch)
- Umfangreicher Beitrag auf Winhistory.de von Michael Kahoun
- Umfangreiche Reportage über OS/2 von Version 1 bis Warp 3 (englisch)
- Artikel über OS/2 Warp 4
Kategorien
Hardware
Bussystem
CPU-Sockel
Chipsatz
Computer
Gehäuse
Grafikchip
Hardware (Produkt)
Hardwarehersteller
Internet (Hardware)
Mikrocontroller
Mikroprozessor
Netzwerkgerät
Programmierbare Logik
Schnittstelle (Hardware)
Soundchip
Speicherkarte
Speicherlaufwerk
Speichermedium
Speichermodul
Standard (Hardware)
Steckkarte
Urheberrecht
 Text und Bilder der Lexikonartikel stammen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License.
Text und Bilder der Lexikonartikel stammen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License.